Professor Dr. Jalid Sehouli – Frauenarzt, Schriftsteller, Ordinarius an der Berliner Charité – stellt sich im Interview mit arztundkarriere.com den Fragen zur problematischen Vermittlung von negativen Botschaften in der Arzt-Patienten Beziehung, welche er in seinem neuesten Buch „Von der Kunst schlechte Nachrichten gut zu überbringen“ behandelt.
„Von der Kunst, schlechte Nachrichten gut zu überbringen“ ist nicht Ihre erste Publikation. Was genau hat Sie dazu inspiriert, Bücher zu schreiben?
Generell gehört das Schreiben zu den allerhäufigsten ärztlichen Tätigkeiten, wie zum Beispiel Arztbriefe oder wissenschaftliche Publikationen zu verfassen. Man kann Schreiben auch dafür nutzen, um Emotionen und Konflikte auszudrücken, so wie mit Malen oder über Musik. Ich habe die Literatur für mich als Entschleunigung genutzt und das Schreiben für mich als Prozess für Reflektion, Orientierung und Lösungsfindung entdeckt. Daraufhin habe ich mich entschieden, aus den bisherigen Ergebnissen ein Buch für die Öffentlichkeit zu fertigen. Dabei stellte sich die Frage, ob es eher in die philosophische oder originär-medizinische Richtung gehen sollte – letzten Endes wurde es eine Mischung aus beidem. So ist mein Buch „Marrakesch“ entstanden und wurde zu einem großen Erfolg.
Gab es einen ausschlaggebenden Moment für das neue Buch zum Thema „schlechte Nachrichten“?
Ein Buch zu schreiben bietet die Möglichkeit, sich strukturiert und intensiv mit einem Thema auseinanderzusetzen. Vor fast zwanzig Jahren operierte ich beispielsweise eine ältere Frau, die die Operation gut überstand. Als man der Nachbarin die gute Nachricht übermitteln wollte, teilte sie uns aber mit, dass der Ehemann der Patientin, ein 94-jähriger Mann sich erschossen hatte – er hatte zu viel Angst, seine Frau zu verlieren. Das war ein Moment, in dem ich mich alleingelassen gefühlt habe und ich habe es nie vergessen und konnte es auch nie aufarbeiten. Ich nutzte das Buch als wichtiges Medium, um damit abschließen zu können.
Das Kommunikationstraining ist seit einigen Jahren Pflicht in den meisten Medizinstudiengängen. Wie ist es aber mit dem zwischenmenschlichen Umgang mit Patienten: Werden angehende Ärzte auch in diesem Bereich geschult?
Nicht in allen Universitäten ist das Teil des Ausbildungskonzeptes. An der Charité arbeiten wir schon seit vielen Jahren mit sogenannten Simulationspatienten und haben Kurse entwickelt, welche Kommunikations-, Interaktivitäts- und Interaktionstechniken, anhand von Kommunikationsstrategien thematisieren und reflektieren. Ausreichend ist das jedoch nicht. Denn im Berufsleben eines Arztes kann dieser bis zu 200.000 schwierige Gespräche führen, ohne sich in Sachen Kommunikation fort- und weitergebildet zu haben. Ich denke, dass die Kommunikation aber noch mehr Raum im Medizinstudium erhalten muss. Hierbei meine ich die Kommunikation mit Patienten, Angehörigen, aber auch mit anderen Kollegen und Berufsgruppen.
Was sind gerade bei der Übermittlung von schlechten Nachrichten Ihrer Meinung nach die größten Hürden für Ärzte?
Oft fehlt die Reflexion und Supervision seiner eigenen Kommunikation und seines Gespräch Stils. Zwar gibt es Trainingskurse zu verschiedenen Operationstechniken, wie aber kommuniziere ich mit Patienten? Wie übermittle ich eine schlechte Nachricht? Und wie gehe ich damit um, sehr schlechte Botschaften übermitteln zu müssen, die den Blick auf das Leben für immer verändern können? Hier wird man als Arzt quasi alleingelassen, denn eine Orientierung hierfür gibt es nicht. Achtsamkeit ist meines Erachtens das Stichwort – zu spüren, ob das, was man kommuniziert auch für die Patienten verständlich ist – positiv oder negativ. Außerdem ist wichtig zu schauen, ob meine Informationen und Botschaften tatsächlich angekommen sind.
Eine negative Botschaft sollte angekündigt werden, denn der Patient braucht Zeit und Raum, sich zu einem auf die schlechte Nachricht einzustellen sowie diese zu verdauen. Daher sollte der Überbringer einer schlechten Nachricht ganz bewusst Pausen einlegen und nicht selbst zu viel sprechen. Zudem wissen wir uns häufig nicht zu vergegenwärtigen, was die Nachricht zur Krankheit für den Mensch und seiner Zukunft bedeutet, der vor uns sitzt. Was bedeutet es beispielsweise für den Patienten selbst, für dessen Familie oder Berufsleben, wenn dieser eine unheilbare Krebserkrankung hat? Man muss lernen, zu beobachten, was die Botschaft mit dem Menschen macht, ohne diese zu bewerten. Somit ist es essenziell herauszufinden, was ich als Übermittler tun kann, um dem Empfänger wieder Lebensmut oder eine gewisse Dynamik zu verleihen. Das sind strukturierte analytische Konzepte, die wir Ärzte oft nicht lernen, vielmehr mogeln wir uns von einem Gespräch zum anderen.
Wie würden Sie die „ideale“ Überbringer-Empfänger-Beziehung zwischen Arzt und Patient beschreiben?Eine Definition der idealen Arzt-Patienten Beziehung existiert nicht, das sollte auch nicht der Anspruch vor einem Gespräch sein. Bei der Kommunikation zwischen Arzt und Patient sollte er vielmehr darin liegen, dass beide Gesprächspartner hinterher bereit sind, sich erneut zu treffen. Ziel ist es, eine Beziehung aufzubauen, die auf Ehrlichkeit beruht, ohne alle Lösungsstrategien sofort parat haben zu müssen. Ich bin selbst sehr trainiert in Gesprächen, führe allerdings immer noch viele nicht perfekte Gespräche durch. Der Unterschied zu vielen Kollegen ist aber, dass ich es bemerke. Das ist wie bei Operationen: Man wird sie nie ganz ohne Komplikation durchführen können. Aber es geht darum, die Fehler zu merken und zu beheben. Das ist die Kunst.
Aufgrund der Digitalisierung steigt die räumliche Distanz zwischen Arzt und Patient, dabei fallen wichtige Kommunikationsmittel wie Gestik und Mimik weg. Wird das zu einer besonderen Herausforderung vor allem für den medizinischen Nachwuchs?
Ja und nein. Digitalisierung kann nur unterstützend wirken, wichtig bleibt immer die menschliche Begegnung. Sie bedeutet kein entweder oder, Digitalisierung gehört dazu. Am Ende des Tages bleibt im Destillat die Achtsamkeit in der menschlichen Begegnung zwischen Arzt und Patient. Der Umgang mit der Digitalisierung muss gelernt werden, ohne dass das Arzt-Patienten-Verhältnis darunter leidet.
Sind Emotionen in der Arzt-Patienten-Beziehung überhaupt angebracht?
Natürlich, warum denn nicht? Als Arzt kann man nicht sagen: „Ich bin traurig“ oder „Ich bin bedrückt“. Als Arzt weiß ich auch nicht, wie sich ein Patient fühlt, aber ich kann es erahnen. Ich selbst darf keinesfalls die Rolle des Betroffenen einnehmen. Nichtsdestotrotz ist Empathie wichtig – auf einer professionellen Ebene eben. Das heißt nicht, dass man nicht sym- oder empathisch ist, jedoch gilt es Mechanismen zu entwickeln, um mit dieser schweren Last klarzukommen und professionell zu bleiben.
Gibt es drei ausschlaggebende Tipps, die Sie angehenden Medizinern im Umgang mit Patienten bezüglich der Vermittlung schlechter Nachrichten mit auf den Weg geben würden?
Erstens: Es beginnt mit der Haltung, dass ich als Mediziner es auch so möchte, dass das Gespräch die wichtigste Arznei ist und so mit dem Thema auch umgehe. Man muss sich bei der Überbringung schlechter Nachrichten die Zeit zur Selbstreflektion nehmen, um zu erkennen, wie man selbst damit umgeht.
Zweitens, sollte man versuchen, sein Gegenüber zu beobachten, um zu lernen wie die Nachricht aufgenommen wird und ob diese verständlich vermittelt wurde. Das ist wichtig für den Lernprozess. Das bedeutet auch, alle Emotionen des Gegenübers zu akzeptieren, ob das nun Wut, Trauer, Melancholie oder Albernheit ist – ohne diese zu bewerten. Im Falle einer negativen Nachricht, ist es empfehlenswert, eine Warnung auszusprechen wie „Ich habe eine schlechte Botschaft“. Das gibt dem Patienten die Möglichkeit, sich auf das, was kommt, mental vorzubereiten. Zuletzt sollten Mediziner sich auch immer auf die positiven Aspekte konzentrieren.
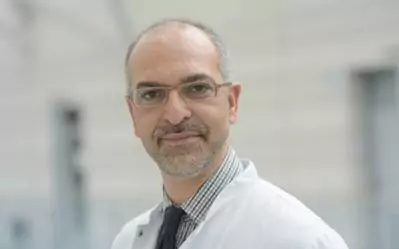
Einer von Dr. Sehouli‘s derzeit wissenschaftlichen Schwerpunkten ist das „Langzeit-Überleben“. Er versucht zu untersuchen, warum Menschen trotz unheilbarer Erkrankung lange und gut leben und arbeitet hierzu an einem großen wissenschaftlichen Projekt.
Weitere Erfahrungsberichte finden Sie unter: arztundkarriere.com/erfahrungen-und-essays

