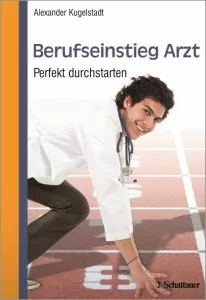Wie können angehende Ärzte ihren Berufseinstieg zufriedenstellend gestalten? Dr. Alexander Kugelstadt gibt Antworten.
Viele Berufseinsteiger empfinden die erste Zeit des Einstiegs in das Berufsleben als frustrierend. Die Entwicklungsmöglichkeiten sind anfangs oft zu gering und mitunter bleiben gesundheitliche Folgen nicht aus. Alexander Kugelstadt hat sich mit der Frage auseinandergesetzt, wie junge Ärzte ihren Einstieg dennoch erfolgreich meistern können.
Arzt sei der schönste Beruf überhaupt, sagt man oft. Aber wieso eigentlich? Gute Gründe gibt es viele: Der Arztberuf ist von seiner Natur aus ein freier Beruf, das heißt keine Behörde schreibt dem Arzt vor, wie er die Heilkunde auszuüben hat. Vielmehr kann man im Rahmen der ärztlichen Selbstverwaltung direkt mitgestalten, wie die wissenschaftlichen, ethischen und formalen Standards der Berufsausübung aussehen sollen. Andere große Vorzüge des Berufes sind hohe Flexibilität in einem nach Medizinern schreienden Arbeitsmarkt – nicht nur im kurativen Bereich – sowie eine sehr sinnhafte tägliche Beschäftigung. Insgesamt kann man von unschlagbaren Möglichkeiten sprechen, sich fachlich und persönlich stetig weiter zu entwickeln.
Auf einen gelungenen Abschluss im Bereich Medizin folgt: Ernüchterung
Dennoch denken sicher die meisten Kollegen nicht gerne an die Zeit des Berufseinstieges zurück: Nachdem der erfolgreiche Abschluss des Medizinstudiums beinahe Flügel verliehen hat, kommt oft eine Ernüchterung. Die erste Phase des ärztlichen Berufslebens ist für viele frustrierend. Eigene Entscheidungsspielräume sind meist gering, laut einer großen Studie entwickeln 64 Prozent der jungen Ärzte im Krankenhaus gesundheitsschädlichen Disstress 1. Die Hauptprobleme liegen im Bereich der Arbeitsorganisation und Arbeitszeitgestaltung. Auch bleibt die Realität der ärztlichen Weiterbildung oft hinter den Erwartungen der Mediziner zurück.
Um dem Missverhältnis von Potenzial und den Belastungen des Arztberufes im Rahmen des Berufseinstieges auf die Schliche zu kommen und den eigenen Berufseinstieg zu planen, hilft es, sich die anspruchsvollen Gegebenheiten dieser Phase klar zu machen: Während sich an der Uni alles um den angehenden Arzt drehte und viel für dessen Ausbildung geboten wurde, prallen in den Kliniken die Interessen aufeinander. Der Klinikbetreiber möchte etwas anderes, als der Krankenpfleger und die Patienten haben oft Ansprüche, die mit den Planungen des stationsärztlichen Tagesablaufes ganz und gar nicht zusammenpassen. Wenn man hier nicht aufpasst und über das Fachliche hinaus ein Konzept hat, um sich zu organisieren, können die ersten Monate schnell zur Qual werden. Oft ist es gar nicht leicht zu registrieren, vor wessen Karren man gerade gespannt wird.
Der zweite Haken ist: Als junge Ärztin oder junger Arzt ist man – mangels einschlägiger Berufserfahrung – letztlich nur mit den Strukturen einer Klinik oder Praxis arbeitsfähig, durch die Supervision des Facharztes, Oberarztes oder Chefarztes beziehungsweise des Praxisbetreibers. Das erzeugt in den ersten Berufsjahren ein hohes Maß an Abhängigkeit, zumal man von seinem Chef ja irgendwann ein „Facharztzeugnis“ erhalten möchte, und so ständig ein kleines – manchmal nur phantasiertes – Druckmittel besteht. Wie wird man trotzdem zum zufriedenen Berufseinsteiger?
Mit dieser Frage habe ich mich ausführlich in meinem Buch „Berufseinstieg Arzt“ beschäftigt. Hier möchte ich Ihnen exemplarisch drei Punkte schildern, mit denen eine Beschäftigung vor Beginn der Arzttätigkeit unbedingt zu empfehlen ist. Viele tun das leider erst dann, wenn sie bereits unter ihrer beruflichen Situation leiden.
Die Qual der Wahl: Die allererste Stelle
Über die Hälfte aller Krankenhäuser haben Probleme ihre Arztstellen zu besetzen. Eigentlich gut für junge Ärzte, oder? Ja, aber auch problematisch. Denn Sie wissen nicht, welche Stelle wirklich lohnend ist und wo nur das nächstbeste Arbeitspferd gesucht wird – ohne langfristiges Interesse. Die Versprechen der Chefärzte sind in den meisten Vorstellungsgesprächen umfangreich. Eine Möglichkeit ist immer, in einer Klinik anzufangen, die Sie noch aus dem Praktischen Jahr oder Famulaturen kennen und in positiver Erinnerung haben. Sonst müssen Enttäuschungen auf anderem Wege vermieden werden.
Das Problem einer Abteilung mit schlechtem Arbeitsklima, wenig Zusammenhalt im Team oder wirtschaftlichen Schwierigkeiten ist nämlich, dass dann für Ihre Einarbeitung wenig Zeit und Muße vorhanden sein wird. Und es macht keinen Spaß morgens zur Arbeit zu gehen. Dabei geht es beim ersten Klinikjob um Vertrauen! Ihr Chef oder seine Oberärzte übertragen Ihnen Aufgaben, für die sie Sie qualifiziert halten und Sie wissen, sich im Zweifel rückversichern zu dürfen, beziehungsweise Fehler gemeinsam analysieren zu können, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern. Wenn das nicht geht, kann es wirklich ungemütlich werden. Deshalb: Testen Sie vorher Ihre Wunschstelle auf Herz und Nieren.
Hospitieren Sie! Kein Mitarbeiter kann Ihnen den ganzen Tag etwas vorspielen. Sie werden schnell merken, wie man miteinander umgeht und ob man mit Interesse auf Sie zukommt. Fragen Sie die Kollegen und Vorgesetzten doch, was Sie alles wissen möchten, zum Beispiel: Wie ist die Weiterbildung, der Teamgeist, die Arbeitsbedingungen, die Fortbildungen? Funktionieren die Rotationen? Darf man operieren? Welche Funktionen können erlernt werden? Wie ist die Vergütung? (und alles weitere, was Ihren individuellen Vorstellungen nach wichtig ist). Bedenken Sie, dass Zurückhaltung eine wichtige Tugend ist, bei Verhandlungen aufgrund der Stellensituation aber auch konkrete Verabredungen zu Ihren Gunsten getroffen werden können.
Ein Muss für die ärztliche Weiterbildung: Die Weiterbildungsordnung auswendig kennen
Mit der Approbation als Arzt hört das Lernen nicht auf, denn die allermeisten wollen eine Facharztanerkennung im Wunsch-Fachgebiet erwerben. Diese Wahl ist natürlich sehr individuell mit oft gemischten, aber eher medikamentösen, chirurgischen oder psychotherapeutischen Heilversuchen, während die Gründe für eine Facharzturkunde auf der Hand liegen: Qualifikationsnachweis mit der Möglichkeit zur Ausübung einer leitenden oder selbstständigen ärztlichen Tätigkeit und bessere Bezahlung.
Das Wichtige ist: Wenn Sie Ihr Wunschgebiet gefunden haben sollten, Sie in- und auswendig wissen, was in der Weiterbildungsordnung der Landesärztekammer Ihres Bundeslandes (in dem Sie arbeiten) steht. Die Delegiertenversammlung handelt jährlich neu aus, was Sie in einem Zeitraum von vier bis sechs Jahren alles gemacht haben müssen, um in einem der 33 medizinischen Fachgebiete die Facharztanerkennung zu erhalten.
Problem: Diesen ganzen Katalog zu erfüllen, geht oft im klinischen Alltag unter und Sie sind abends froh, wenn Sie die Station in trockenen Tüchern haben. Da fallen die Gastroskopien, Ergometrien oder das Intensivjahr schnell mal hinten runter – zu Ihren Ungunsten. Ihr Weiterbildungsbefugter, meistens der Chefarzt oder Praxisbetreiber, ist wie die Ärztekammer Ihr Ansprechpartner in Weiterbildungsfragen. Nutzen Sie das, um so schnell wie möglich Fachärztin oder Facharzt zu werden. Die Weiterbildungskataloge der 17 Landesärztekammern sind teilweise sehr unterschiedlich, dazu kann man in meinem Buch mehr erfahren.
Zusammenhalt: Auf Kollegen Acht geben und aktiver Teil des Netzwerkes sein
Ärzte sind Teamplayer. Nur, wenn Ärzte zusammenhalten und sich unterstützen, kann die fachliche Kompetenz und das Können des Einzelnen seine ganze Stärke erreichen, wie auch der gesamte Berufsstand. Im kleinen Mikrokosmos kann Kollegialität so aussehen: Morgens wenn Sie zum Dienst kommen, holen Sie sich aktiv die Übergabe vom Nachdienst ab. Denn wer müde ist, arbeitet meistens völlig ineffektiv weiter und gibt angefangene Aufgaben nur ungern ab. Doch derjenige powert sich aus, und gerade die Erholung nach einem Nachtdienst ist wichtig – was oft nicht ins Selbstbild des Arztes passt. Achten Sie auf Kollegen, und verlangen auch Sie einen humanen Umgang mit Ihnen und Ihren Ressourcen. Der rücksichtslos schuftende Arzt, der irgendwann erschöpft umfällt, hat ausgedient.
Im Makrobereich ist zu überlegen, ob Sie sich jenseits von Krankenhaus- oder Praxisgrenzen für die Weiterentwicklung der Medizin und der Ärzteschaft einsetzen: Ob in einer wissenschaftlichen Fachgesellschaft, einem Berufsverband, der Ärztekammer oder einer Gewerkschaft – der Arztberuf hält diverse Möglichkeiten bereit, die eigene berufliche Zukunft mitzugestalten. Irgendeine dieser Möglichkeiten sollte man ergreifen – man bekommt mehr mit, ist Teil eines Netzwerkes und geht nicht in der täglichen Routine unter.
Die große Herausforderung bei den vielfältigen Eindrücken und Einflüssen im Rahmen des Berufseinstieges als Arzt ist es nämlich, die eigenen Ziele im Blick zu behalten. Viel Erfolg!
Alexander Kugelstadt, Dr. med., studierte an der Medizinischen Hochschule Hannover. Heute ist er Facharzt für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie.
Alexander Kugelstadt (2014):
Berufseinstieg Arzt. Perfekt durchstarten. Schattauer Verlag.
Mehr zum Berufseinstieg finden Sie hier.