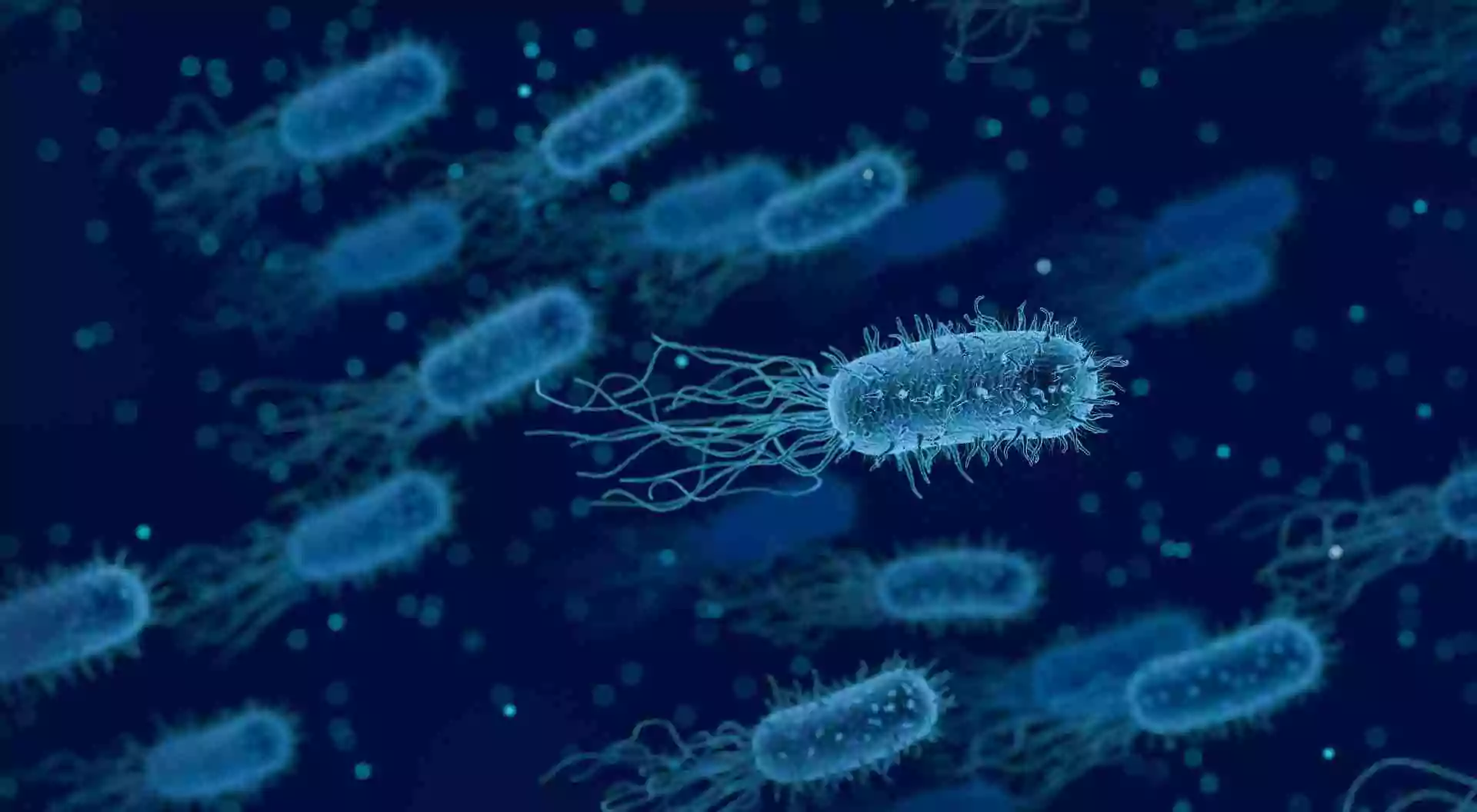Seit der ersten Entdeckung von Penicillin hat sich viel getan – der Arzneimittelmarkt hat inzwischen gegen fast jede Krankheit ein Medikament. Doch noch immer wird an neuen Antiinfektiva geforscht, um dem Krankenhauskeim Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus – kurz MRSA – an den Kragen zu gehen. Dieses Problem entstand ja erst durch die vielen verschiedenen Antibiotika und der falschen Anwendung.
Regelmäßig werden Statistiken veröffentlicht, wie viele Menschen sich jährlich mit resistenten Keimen, wie dem MRSA in Krankenhäusern infizieren und wie viele Patienten daran sterben. So haben sich im Jahr 2018 in Mitteldeutschland laut Robert Koch-Institut weitaus weniger Menschen mit einem solchen Erreger infiziert als noch im Vorjahr (Quelle). Auch die Charité Berlin schafft es immer wieder in die Schlagzeilen, da Keime für den Tod von Frühchen verantwortlich sein sollen (Beispiel 2018; Keime auf der Station). Abgesehen von vereinzelten Antibiotika scheint es aktuell aber keine erfolgreichen Waffen gegen MRE wie gramnegative Stäbchenbakterien zu geben.
Um multiresistente Erreger wirksam zu bekämpfen, müssen ohne Zweifel neue Methoden und Medikamente gefunden werden. Eine erfolgreiche Strategie beinhaltet aber nicht nur Mittel, um vorhandene Erreger zu entfernen oder zu dezimieren, sondern bezieht auch die Infrastruktur mit ein – also die Übertragung und Ausbreitung so gut wie möglich zu unterbinden. Dazu reicht es nicht, gemäß § 23 Abs. 1 IfSG, entsprechende Erreger zu dokumentieren, sodass das Gesundheitsamt darauf Zugriff erhalten und entsprechend reagieren kann.
Während viele Pharma-Firmen nicht weiter an neuen Mitteln forschen, da es teilweise zu teuer und wenig ertragreich ist (berichtet Holger Zimmermann von AiCuris im Focus), haben sich andere Firmen damit beschäftigt, neue Lösungen zu finden
Unterstützung kommt vom UVD Roboter aus dem Haus Blue Ocean Robotics. Dieser fährt autonom durch Krankenhäuser, ähnlich einem Staubsaugerroboter und desinfiziert die Räumlichkeiten mithilfe von UV C-Licht. Das konzentrierte, ultraviolette Licht zerstört die DNA-Struktur von Bakterien, Viren und anderen schädlichen Organismen und tötet sie somit ab. Gegen die Strahlung können diese Keime nicht resistent werden, jedoch ist das UV C-Licht auch für den Menschen gefährlich. Es kann Hautreizungen und Schäden an den Augen verursachen, deswegen kommt der Roboter nur in geschlossenen Räumen zum Einsatz. Dort ist er lediglich als Ergänzung zur manuellen Reinigung gedacht, sorgt aber für eine 99,9 prozentige Beseitigung aller Keime (ein gewisser Werbespruch lässt grüßen). Weitere Orte, an denen der Roboter eingesetzt werden könnte sind Labore, in der Lebensmittel-Produktion oder allen anderen Reinräumen.
Ein weiterer Lichtblick im Kampf gegen die MRE ist eine Meldung des Helmholtz Instituts für Pharmazeutische Forschung Saarland (HIPS) und des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung (HZI). Auf der Suche nach einem weiteren Naturstoff, der die multiresistenten Keime abtöten kann, wurde die Forschung zu Bottromycinen weiter voran gebracht. Bottromycine und deren Wirksamkeit gegen resistente Keime wurden bereits in den 1950er Jahren entdeckt. Es handelt sich dabei um einen von Bakterien produzierten Naturstoff mit antibiotischer Wirkung. Die Forschungsgruppe „Strukturbiologie biosynthetischer Enzyme“ von Prof. Dr. Jesko Köhnke untersucht detailliert, wie Bakterien die Bottromycine herstellen, damit die Substanz weiterentwickelt werden kann. Nun ist es ihnen gelungen, das Enzym PurAH zu identifizieren, das ein wichtiger Baustein zur Bildung von Bottromycinen ist und in dem mehrstufigen Herstellungsprozess innerhalb der Bakterien zusätzlich zu seiner Funktion als Enzym eine Art Qualitätskontrolle durchführt. Dies stellt sicher, dass die Bakterien am Ende auch die richtige Substanz herstellen. Mit dieser Entdeckung kann weiter an der Verbesserung des Wirkstoffes gearbeitet werden.
Da jede Klinik vor ähnlichen Herausforderungen steht, haben sich auf lokaler Ebene sogenannte MRE-Netzwerke gebildet. Das ist zu begrüßen, allerdings sollten diese Vereinigungen nicht ausschließlich dazu dienen, sich gegenseitig in der Öffentlichkeit Siegel zu übergeben und Absichtserklärungen zu kommunizieren. Genauso wichtig ist, die Ausbildung der Infektiologen stärker zu unterstützen – damit zukünftig jeder Klinik ein entsprechender Experte zur Verfügung stehen kann. Dank Digitalisierung ließen sich konkrete Tools sowie Netzwerke schaffen, die im Bedarfsfall Betroffene sowie Experten sofort informieren und zusammenbringen.
Mehr zu Digital: Best Practice finden Sie unter: arztundkarriere.com/digital-best-practice
Mehr zur Digitalisierung in der Medizin unter: arztundkarriere.com/medizin-digital