Dr. med Umes Arunagirinathan, Herzchirurg am Klinikum Links der Weser in Bremen, ist Autor des vielbeachteten Buches „Der verlorene Patient“. Er wirft darin einen kritischen Blick auf die strukturellen, ökonomischen und personellen Restriktionen, mit denen Ärzt:innen heute zu kämpfen haben. Im Interview gibt er wertvolle Tipps, wie man den Herausforderungen des Berufseinstiegs begegnen kann.
Wie genau können die Nachwuchsmediziner:innen die für sie richtige Weiterbildung beziehungsweise das richtige Fachgebiet finden?
Sehr wichtig ist die praktische Erfahrung in den Fachgebieten (Praktika, PJ, Hospitation). Sie sollten dort die Chance nutzen, die Kolleg:innen aus dem Fachgebiet zu fragen, wie ihr Alltag aussieht. Und natürlich die Frage, ob sie in dem jeweiligen Fachgebiet die Möglichkeit haben, sich niederzulassen. Ich finde, die Fachgebiete sollten zu der eigenen Lebensplanung passen.
Ein Zitat aus Ihrem Buch ist: „Zur Freiheit gehört übrigens auch, dass ich in meiner Facharztausbildung nicht von einem Chef abhängig bin, dessen Bonusauszahlungen mit dem Umsatz der Klinik verknüpft sind.“ Wenn dies nicht der Fall ist, welche Konsequenzen kann dies für Assistenzärzt:innen in Weiterbildung haben?
Ich kenne aus dem persönlichen Umkreis sehr viele Kolleg:innen, die ihre Facharztausbildung nicht in dem von der zuständigen Ärztekammer vorgegebenen Zeitfenster absolviert haben. Die meisten Chefärzt:innen fühlen sich nicht verpflichtet eine Ausbildung in dem zeitlichen Rahmen durchzuführen. Ich habe bisher nicht einmal einen Ausbildungsvertrag gesehen, außer einen Arbeitsvertrag, in dem von einer Weiterbildungspflicht keine Rede war. Wenn ich nicht innerhalb der vorgegebenen Zeitfenster ausgebildet werde, bedeutet das, dass ich meinen Facharzt nicht erhalte und die Bezahlung als Assistenzarzt/-ärztin fortgeführt wird. Wenn man schon ein paar Jahre in einer Klinik seine Ausbildung macht, ist man abhängig vom Chefarzt oder der Chefärztin, denn ein Wechsel in eine andere Klinik bedeutet immer zusätzlicher Zeitverlust. Wir haben keinen Facharztkatalog, der klar vorlegt, welche Fähigkeiten wir in welchem Ausbildungsjahr erlernen müssen. Keine Institution wie zum Beispiel die Ärztekammer kontrolliert, ob wir in der Klinik auch wirklich ausgebildet werden. Die starke, unkontrollierbare Abhängigkeit einzelner Assistenzärzt:innen von den Chefärzt:innen beeinträchtigt natürlich die persönliche Freiheit, denn nicht eigener Wille und Leistung machen Assistenzärzt:innen zum Facharzt, sondern allein die Zustimmung der Chefärzt:innen.
Wie genau können Ihrer Meinung nach junge Mediziner:innen erkennen, ob die in Frage kommenden Weiterbildungsbefugten in einem Krankenhaus tätig sind, welches unter einem hohen ökonomischen Druck steht?
Von außen erkennt man das leider schlecht, und beim Vorstellungsgespräch wird kaum ein:e Kolleg:in die Wahrheit sagen, schließlich ist jede besetzte Stelle gut für alle Beteiligten in der Klinik. Ich persönlich würde mehr als einen Tag hospitieren, um aus dem Arbeitsalltag mehr über die Klinik zu erfahren.
Neben dem Krankenhaus als potenziell zukünftiger Arbeitgeber spielt natürlich die fachliche und didaktische Qualität der Weiterbildenden eine entscheidende Rolle. Nach welchen Kriterien würden Sie in der Findungsphase in Frage kommende:n Weiterbilder:in selektieren?
Es ist sehr schwierig, in unserer Krankenhauslandschaft wirklich gute Weiterbilder:innen zu finden. Die Chefärzt:innen sind sehr stark abhängig von der Geschäftsführung und sehen es oft nicht als ihre Pflicht, junge Menschen auszubilden. Oft werden diese eher als billige Arbeitskräfte für den Stationsalltag eingesetzt, so mein Eindruck. Dennoch kämpfen einige Chefärzt:innen, die gute Ausbilder:innen sein und ihr Wissen vermitteln möchten, gegen diese Abhängigkeit. Bei der Hospitation, beziehungsweise dem Vorstellungsgespräch wäre es wichtig zu erfahren, wie viele Fachärzt:innen die Weiterbildenden bisher ausgebildet haben. Und wie viele Assistenzärzt:innen noch wie viele Jahren auf ihre Facharztausbildung in der Klinik warten müssen.
Die gerade novellierten Weiterbildungsordnungen der Landesärztekammern legen fest, was der Standard in der Weiterbildung sein sollte. Welche Eigenschaften und Kompetenzen sollte ein:e Weiterbildungsbefugte:r Ihrer Meinung nach darüberhinaus haben?
Ich finde es sehr wichtig, dass von der Ärztekammer kontrolliert wird, wie viele Fachärzt:innen von den zuständigen Weiterbildungsbefugten ausgebildet worden sind. Es muss gewährleistet sein, dass ein:e Chefarzt/-ärztin die Ausbildung auch tatsächlich machen kann und zusätzlich eine didaktische Basisausbildung zum Unterrichten gemacht hat. Der Lehre gegenüber sollte sich jede:r Chefarzt/-ärztin mindestens genauso verpflichtet fühlen, wie der Wissenschaft und der Klinik. Die Weiterbildungsbefugnis muss von der Ärztekammer jedes Jahr überwacht und kontrolliert werden. Wer keine Weiterbildung macht, darf kein Weiterbildungsbefugnis bekommen. So werden wir es langfristig schaffen, dass junge Kolleg:innen nach dem Studium auch ihre verdiente Weiterbildung bekommen.
Sie sprechen in Ihrem Buch öfter den Ärztemangel, beziehungsweise den Personalmangel in der Medizinbranche, vor allem in den Krankenhäusern, an. Worin liegt dieser begründet und was müsste passieren, um diese Situation zu ändern?
Das Arbeiten in der Gesundheitsbranche hat leider keine Lebensqualität. 24-Stunden Dienste, nicht dokumentierte Überstunden, nicht zu wissen, wann wirklich Feierabend ist – das raubt die Energie. Der Pflegeberuf muss aufgewertet werden und damit meine ich nicht nur bessere Bezahlung, sondern auch Übernahme delegierbare Tätigkeiten, wie Blutentnahmen, Verbandswechsel und Medikamentengabe. Wenn die Ärzte und Ärztinnen im Klinikalltag durch gute Pflegekräfte entlastet werden, dann hat der Arztberuf in Deutschland auch Lebensqualität. Gleichzeitig würden sich viele junge Menschen für den Pflegeberuf interessieren, wenn sie wissen, dass sie mehr machen dürfen, als Betten zu machen, Essen zu verteilen und den ganzen Tag dokumentieren zu müssen.
Gleichzeitig ist in Ihrem Buch ein wichtiges Thema, dass ökonomische Zwänge zu einem massiven Abbau von Krankenhäusern führen können. Schildern Sie unserer Leserschaft doch bitte, wie Sie zu Thesen wie der Bertelsmann-Studie zur notwendigen Bildung von Schwerpunkt-Krankenhäusern stehen und wie Sie generell der Ökonomisierung der Medizin beurteilen.
Wir Ärzte und Ärztinnen müssen ökonomisch denken, um langfristig sozial handeln zu können. Die Wirtschaft hat in der Medizin natürlich ihre Daseinsberechtigung. Wenn aber Wirtschaflter:innen den Mediziner:innen sagen, wie Medizin gemacht werden soll, dann haben die Patienten verloren. Es sind immer wieder die kleinen Krankenhäuser, die keine große Zahl von Operationen im Jahr durchführen und am Ende des Jahres Gewinne erwirtschaften. Gleichzeitig haben wir Krankenhäuser, die jedes Jahr Millionengewinne präsentieren. Wenn man rein wirtschaftlich denkt und handelt, stimme ich den Studienergebnissen zu. Aber auch eine kleine Stadt benötigt neben Kirche, Schule und Bäckerei ein Krankenhaus, denn es geht um Lebensqualität. Die Schwerpunkthäuser muss man nicht an jeder Ecke haben. Planbare Eingriffe, wie Gelenkoperationen oder Transplantationen können in speziellen Zentren wie Zentrum Nord/Süd/Ost oder West gemacht werden. Aber die Krankenhäuser, die die Grundversorgung gewährleisten, sollten auch in kleinen Städten erhalten bleiben. Wenn man die Gewinne und Verluste aller Krankenhäuser in Deutschland addieren würde, sieht es schon mal anders aus. Warum sollen bitte die großen Häuser nicht die kleinen Häuser mitfinanzieren, schließlich kommt das ganze Geld von der Gesamtgesundheitskasse. Es sollte kein:e Wirtschaftler:in die Kliniken führen, sondern jemand, der aus dem medizinischen Bereich kommt und zusätzlich ökonomische Kenntnisse besitzt.
Gerade kommunale Krankenhäuser sind oft defizitär. Wird nicht gerade die Corona-Krise dazu führen, dass in den kommenden 20 Jahren kein Kommunalpolitiker mehr die Schließung eines Krankenhauses fordern wird, weil jetzt doch alle sehr froh sind, ausreichend Kapazitäten in der Nähe zu wissen?
Kommunale Krankenhäuser mögen wirtschaftlich gesehen keinen Gewinn machen, aber sie leisten einen gesellschaftlichen Beitrag, der enorm wichtig für unser Land ist. Eine Ausbildung in einem kommunalen Krankenhaus, wo ein:e Assistenzarzt/-ärztin gefordert ist, ein breites Spektrum an Wissen zu besitzen und Erfahrungen zu sammeln, ist sehr bereichernd. Wir brauchen vielleicht eine Umstrukturierung und in den kleinen Häusern viele Allrounder:innen, statt Spezialist:innen, die ein breites Spektrum an Krankheiten behandeln können. Vielleicht wäre es wichtig, sich immer wieder bewusst zu machen, dass die Finanzierung unseres Gesundheitssystems zur Grundversorgung gehört, wie die Polizei und Feuerwehr.
In Ihrem Buch gehen Sie darauf ein, dass Ärzt:innen einen großen Einfluss auf Patient:innen haben und dieses Vertrauen ausnutzen, in dem sie Therapien unter Ertragsgesichtspunkten verordnen. Wie genau hat die Ökonomie das verursacht?
Man könnte sagen, dass Ärzte und Ärztinnen durch das System zu Manager:innen gemacht werden. Die Leistung unserer Medizin wird von Ökonomen bestimmt, die es in Zahlen, OP-Zahlen oder Millionengewinne, ausdrücken. Solange die Leistung der Medizin nicht auf Patient:innen bezogen wird, auf deren Lebensqualität, werden Ärzt:innen zu Manager:innen geformt.
In Ihrem Kapitel „Darf ́s ein bisschen mehr sein?“ kritisieren Sie die Über-Spezialisierung in den einzelnen Fachgebieten. Wie wappnet sich ein:e junge:r Nachwuchsmediziner:in am besten davor, sich nur noch mit Mikrothemen des eigenen Fachgebietes zu beschäftigen?
Fortbildungen und Rotationen in andere Fachgebiete wären sinnvoll, um den Fokus nicht allein im eigenen Fachgebiet zu verlieren. Nicht das Organ, welches wir als Fachidiot:innen behandeln, ist wichtig, sondern der Mensch, in dem sich das Organ befindet. Deshalb: Die zu behandelnde Person als Ganzes betrachten und immer wieder die Frage stellen, was ihr eine Organbehandlung nützt.
Ebenfalls gehen Sie darauf ein, dass Ärzt:innen im Krankenhaus kaum miteinander kommunizieren. Woran liegt dies begründet und wie kann man vor der Wahl der Weiterbildung herausfinden, ob man in einer Abteilung aus lauter Einzelkämpfern landen könnte?
Leider sind Ärzte und Ärztinnen in den Krankenhäusern Einzelkämpfer. Es gehört oft zur Strategie von Führungspersonen, die Konkurrenz unter den Assistenzärzt:innen zu fördern. Jeder möchte bei den Vorgesetzten einen guten Eindruck machen, durch überdurchschnittliche Leistung in Form von undokumentierten Überstunden oder durch stete Erreichbarkeit. Da die Facharztausbildung nicht einer vorgegebene Reihe folgt, möchte jeder der Nächste sein, der ausgebildet wird. Automatisch stehen Kolleg:innen ohne Facharzt untereinander in Konkurrenz. So generiert man billige Arbeitskräfte und die Abhängigkeit von den Vorgesetzten.
Auch die Work-Life-Balance ist ein wichtiges Kriterium der jungen Mediziner:innen. Sie selber sprechen von einer eher ungesunden Work-Life-Balance im Krankenhaus. Was sollte man von Beginn an beherzigen, um nicht ungesunden Raubbau an sich selbst zu betreiben?
Klare Absprachen vor Beginn der Arbeit mit den Vorgesetzten. Am besten einen schriftlichen Ausbildungsvertrag verlangen. Klare Ansage, dass man mehr als die üblichen Wochenstunden nicht arbeiten möchte. Wer erst einer 56-Stunden Arbeitswoche zustimmt und am Ende von Arbeitsbelastung spricht, ist selbst schuld. Ärzte und Ärztinnen sind Mangelware und bis zur Vertragsunterschrift sollte man alle wichtigen Dinge klären.
Sie selbst sind Herzchirurg. Wo würden Sie heute als junger Mediziner eine Weiterbildung beginnen?
Vor Beginn einer Weiterbildung würde ich mindestens eine Woche in der gewünschten Abteilung hospitieren. Tatsächlich haben die kleinen Häuser oft eine bessere klinische Ausbildung als die großen, mit einer Masse von Assistenzärzten und Assistenzärztinnen.

Weitere Erfahrungsberichte unter: arztundkarriere.com/erfahrungen-und-essays
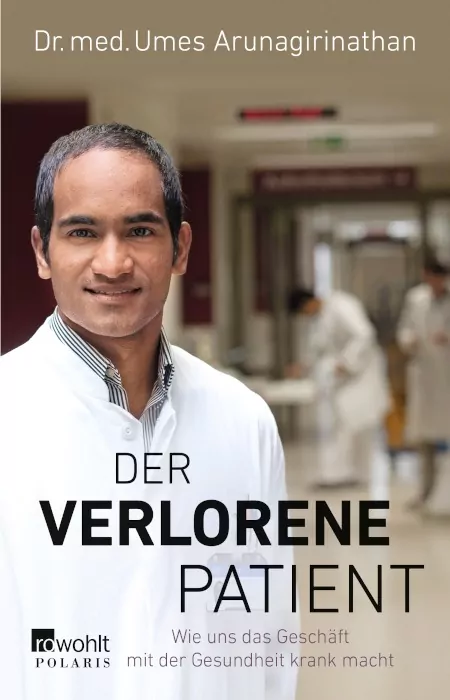
Bei Interesse findest du hier den Link zu seinem Appell an die Medizin.
Rowohlt. 16,00€

